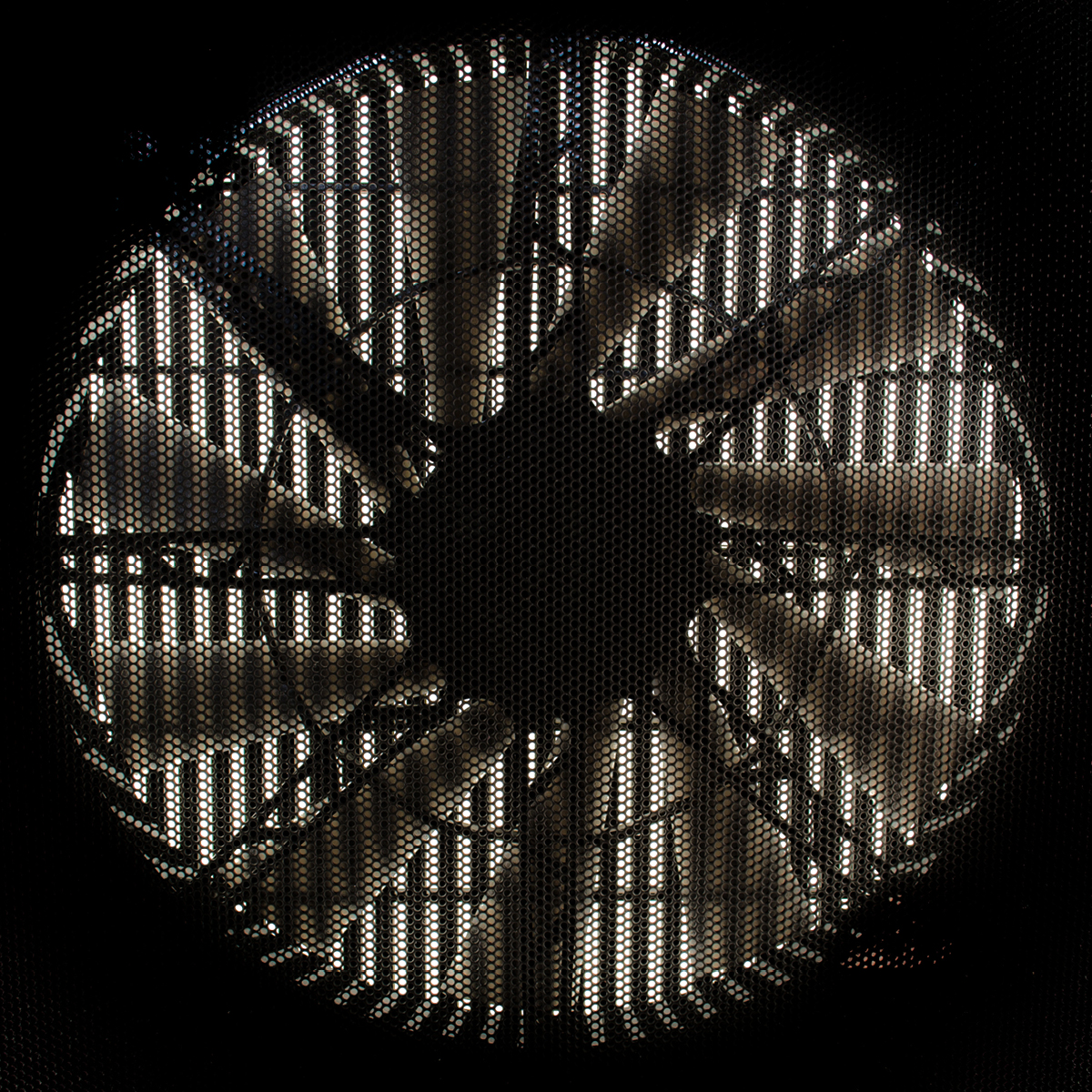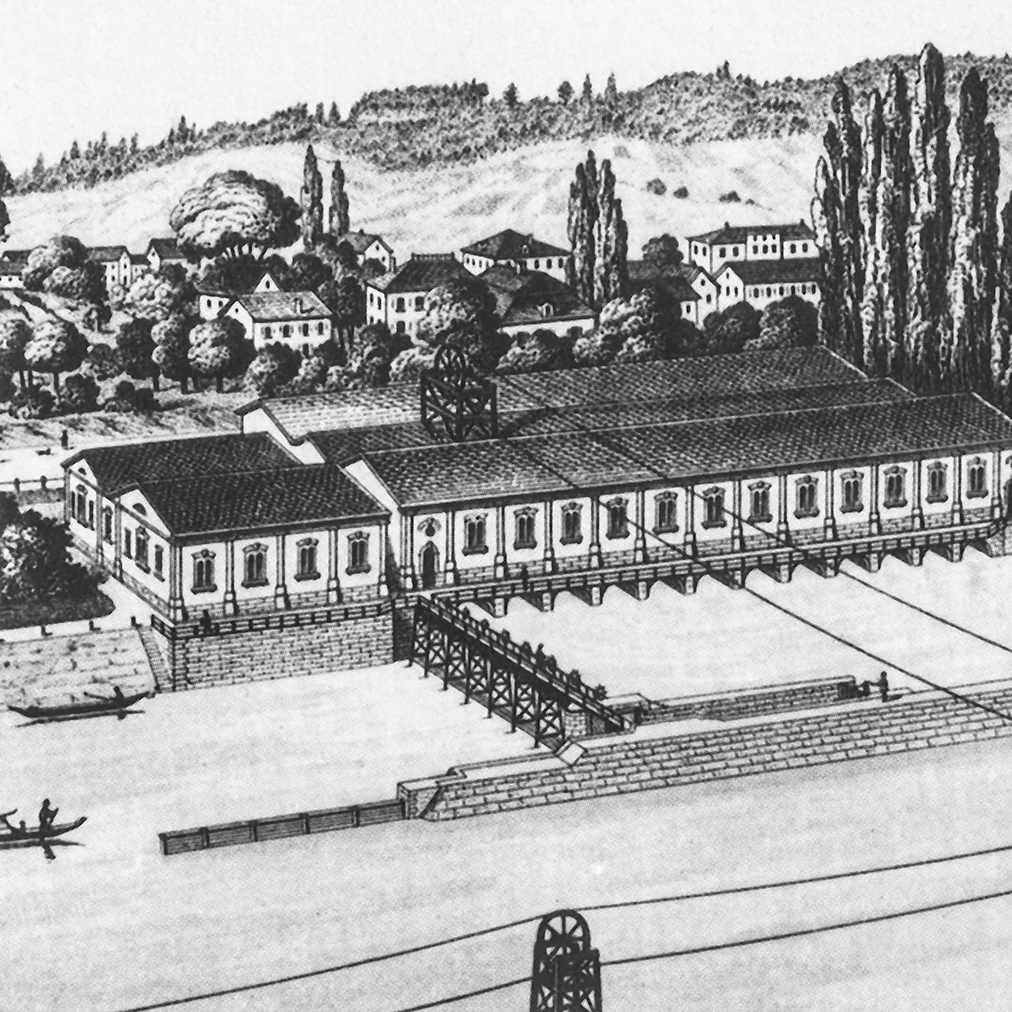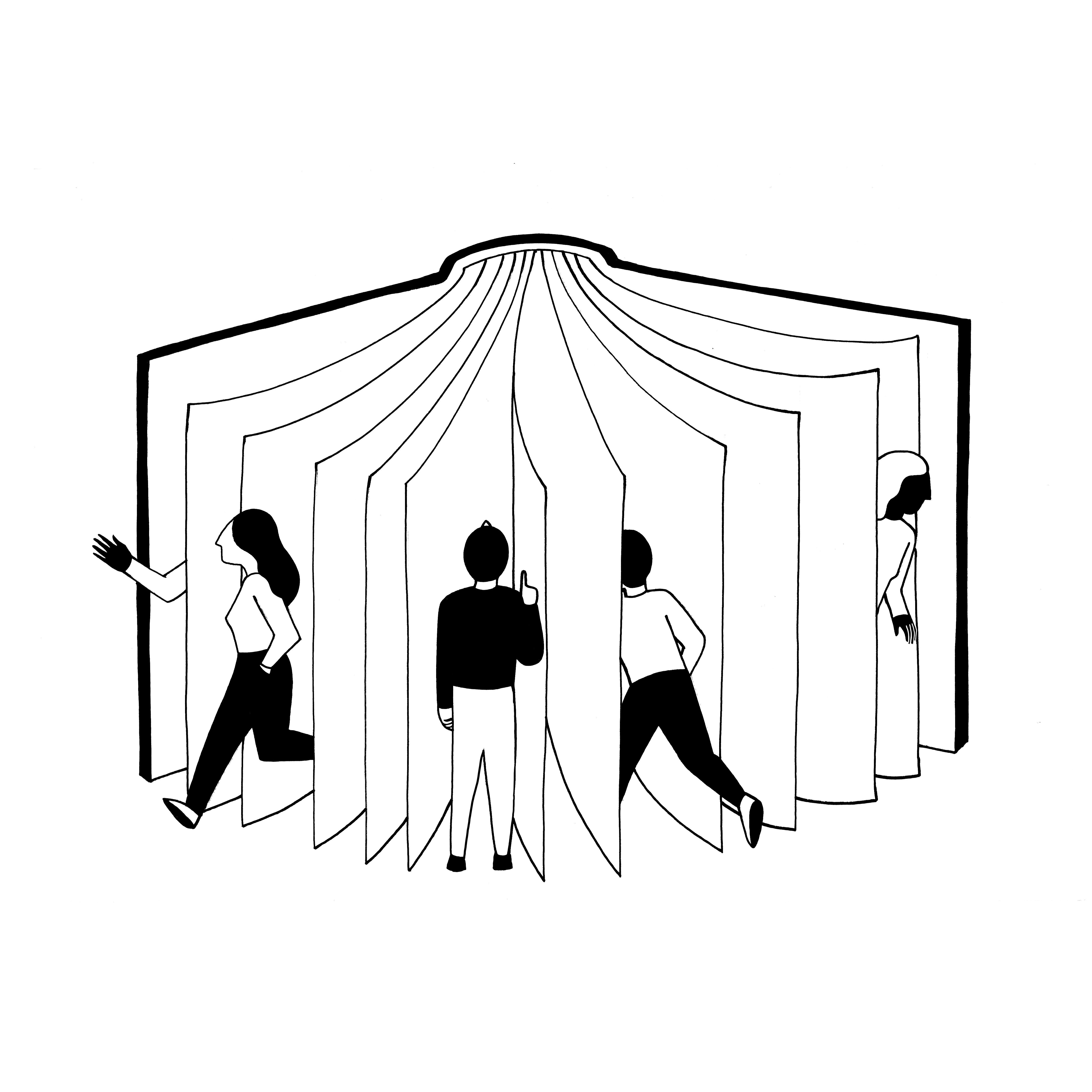Wärmepumpen: die wohl wichtigste Heizform der Zukunft
In der klimaneutralen Welt gehören fossile Brennstoffe wie Öl und Gas der Vergangenheit an. Der Ersatz von Heizgeräten dieser Art wird vielerorts schon forciert – eine klare Strategie, mit welchen Energiequellen und Technologien wir unsere Gebäude in Zukunft beheizen, fehlt aber oft.
Für viele überraschend steht Biomasse – in Form von Stückholz oder Holzschnitzeln – nicht auf der Liste der geeignetsten Energieträger. Der Grund dafür liegt darin, dass Biomasse viel mehr kann, als Gebäude auf 20 °C zu heizen. Etwa wertvollen Winterstrom zu produzieren oder Prozesswärme mit mehreren hundert Grad Celsius für die Industrie zu liefern.
Und das nutzbare Biomasse-Potenzial ist zwar gross, aber dennoch beschränkt – wir sollten es zunehmend für die Anwendungen ausserhalb der Heizkeller reservieren. Zwei aktuelle Studien unterstreichen das: In «Klimaneutrales Deutschland» (Agora Energiewende) werden 2050 noch 10% des Gebäudebestands mit Biomasse beheizt, in «Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem» vom Fraunhofer ISE wird die Biomasse sogar vollständig eliminiert.
Die dominierende Heizungsform wird diesen Studien zufolge die Wärmepumpe sein (mit 45 bzw. 60%). Die zwei wesentlichen Vorteile:
- Der Grossteil der Heizenergie wird der Umgebung (der Aussenluft, dem Erdreich) entnommen und auf ein höheres Temperaturniveau gehievt. Das reduziert den Energieeinsatz um 60 bis 80%.
- Die erforderliche elektrische Antriebsenergie kann aus erneuerbaren Energiequellen stammen.
Wie viel elektrische Energie genau benötigt wird, hängt vor allem von zwei Temperaturen ab: von jener der genutzten Umgebung und von der Vorlauftemperatur der Heizung. Erdreich-Wärmepumpen sind effizienter als Luft-Wärmepumpen; mit einer Niedertemperatur-Heizung kann sparsamer gearbeitet werden als mit konventionellen Radiatoren.
Wichtig ist nun aber die Relation zum Verbrauch: Gut gedämmte Gebäude kommen mit viel weniger Wärme aus als der durchschnittliche Bestand, sodass die Effizienz der Wärmepumpe weniger Bedeutung hat. Hier dürfen mit gutem Gewissen Luft-Wärmepumpen mit mässiger Effizienz eingesetzt werden. Im Neubau-Standard der 80er- und 90er-Jahre muss hingegen die Wärmepumpe auf Hochleistung getrimmt werden: Am besten mit Erdsonden, Flächenheizung und leistungsgeregeltem Verdichter, um auch die letzten Prozente herauszukitzeln.
In Gebäuden mit noch höheren Verbräuchen – i. d. R. Altbestand aus den 70er-Jahren oder älter – hilft die beste Technik nicht: Diese Gebäude sind zuerst thermisch zu sanieren, erst dann können Wärmepumpen sinnvoll zum Einsatz gebracht werden.
Lesen Sie dazu auch meine Gedanken in der Kolumne Effizienz vor Erneuerbaren! sowie die Fortsetzung der vorliegenden Kolumne «Klimaneutral heizen: Wärmenetze».
Sie spielen auch mit dem Gedanken, auf eine effiziente und nachhaltige Wärmpeumpe umzusteigen?
Jetzt Förderbeiträge abklären und Gesuch einreichen bei ewz.