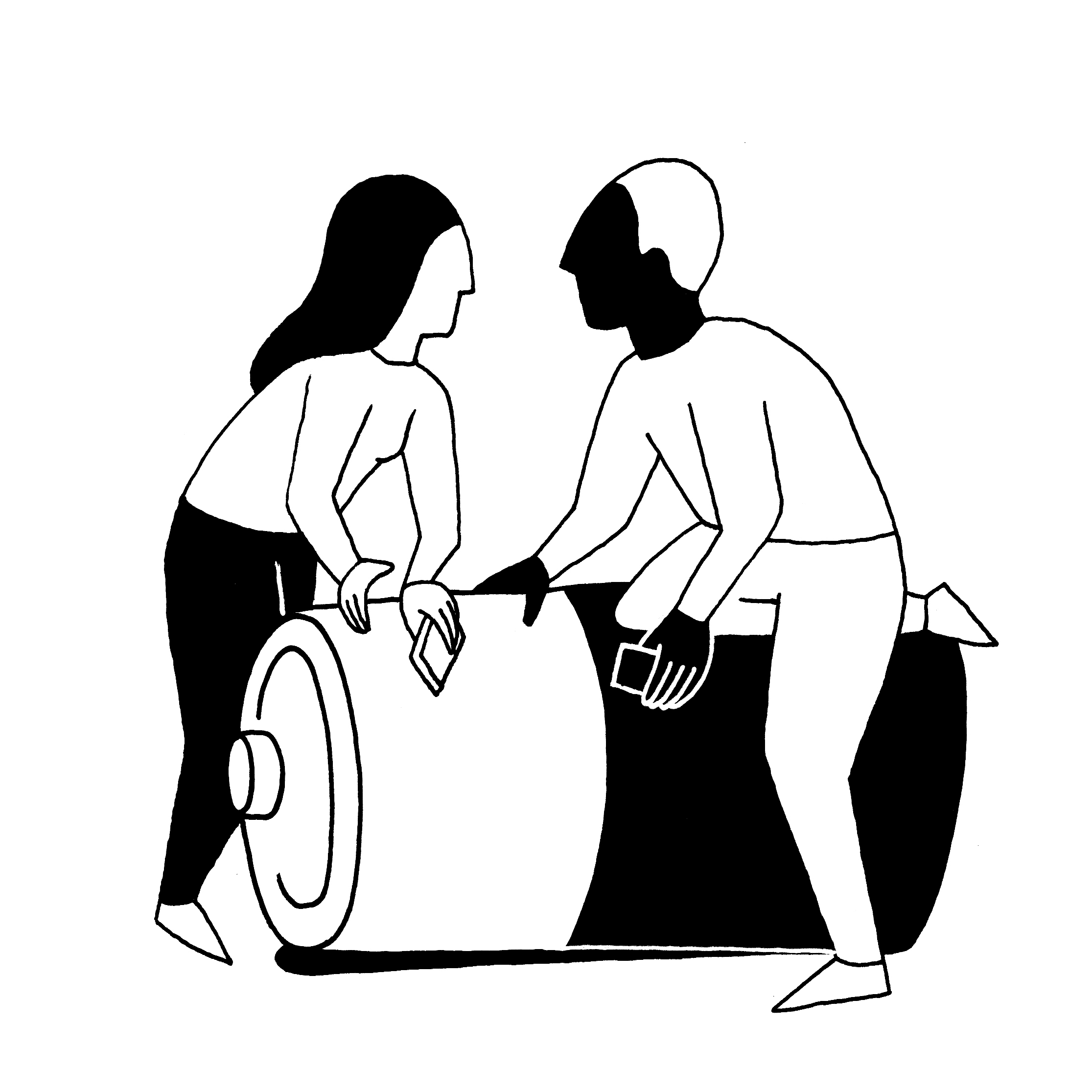So funktionieren 2000-Watt-Areale
2000-Watt-Areale bilden einen energietechnischen und gesellschaftlichen Mikrokosmos für eine nachhaltigere Welt von morgen.
Den Auftakt machte das Projekt Greencity im März 2012. Damals erhielt die Überbauung das Zertifikat «2000-Watt-Areal» und wurde damit nicht nur zur Grundlage des Labels, sondern auch zu seiner ersten Trägerin. Heute ist das Quartier in Manegg eines von fünf Arealen in Zürich, die mit dem Zertifikat ausgezeichnet worden sind. Andere 2000-Watt-Areale in Zürich sind etwa das «Freilager» oder die «Kalkbreite».
Eine Übersicht über 2000-Watt-Areale in der Schweiz bietet die Website des Programms «2000-Watt-Areal».
Im 2000-Watt-Areal zählen nicht nur effiziente Energiesysteme und weniger CO2, sondern auch das Verhalten
Schweizweit existieren im Herbst 2023 50 Areale, die das Label «2000-Watt-Areal» tragen. Viele liegen im Umfeld grösserer Städte. Gemeinsam ist ihnen, dass sie energietechnisch auf die Zielvorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft und auf das Klimaabkommen von Paris ausgerichtet sind.
Die Idee zum Zertifikat entstand bereits im Jahr 2000 im Rahmen des Programms «Energie-Schweiz», mit dem das Bundesamt für Energie (BFE) die Umsetzung der nationalen Energiepolitik in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien fördern wollte.
Ihre gemeinsame Schnittmenge haben 2000-Watt-Areale in den Bereichen Energie und Klima. Im Fokus stehen dabei aber nicht nur neue und effizientere Energiesysteme oder verminderte CO2-Emmissionen, sondern vielmehr auch der Mensch und sein alltägliches Verhalten. Für das Erreichen einer 2000-Watt-Gesellschaft ist gerade dies letztlich von grosser Bedeutung.
«Für ein Leben nach den Grundsätzen der 2000-Watt-Gesellschaft ist es zentral, dass sich die Bewohner der 2000-Watt-Areale dabei gegenseitig unterstützen. Dadurch nehmen sie auch aktiver am Quartierleben teil», sagt Daniel Kellenberger, Projekt- und Regionalleiter der 2000-Watt-Areale in der Deutschschweiz. «So entsteht ein neuer urbaner Lebensstil.»
Leben im 2000-Watt-Areal
Zu jedem Zeitpunkt, sollen pro Person nicht mehr als 2000 Watt, also 2 Kilowatt, Energie verbraucht werden.
Damit dieser Lebensstil auch Realität wird, ist es notwendig, dass das Bewusstsein für eine nachhaltige Entwicklung schon von Anfang an in den 2000-Watt-Arealen präsent ist. Aber auch, dass das tägliche Leben der Bewohnerinnen und Bewohner durch intelligente Mobilitätskonzepte, einen effizienten Einsatz erneuerbarer Energien, diverse Sharing-Angebote und einen geschickten Nutzungsmix der Gebäude unterstützt wird.
Dazu zählen beispielsweise gute Anschlussmöglichkeiten an den öffentlichen Verkehr, die Nutzung von Abwärme für die Wärmeversorgung, PV-Anlagen zu Heizzwecken oder das Vorhandensein von Gemeinschaftsräumen und Gästezimmern auf den Arealen. Auch Kindertagesstätten und die Schaffung von Raum für Gewerbetreibende oder die Gastronomie gehören oftmals zum Konzept von 2000-Watt-Arealen und begünstigen die neue urbane Lebensweise. «Mit dem Bau von 2000-Watt-Arealen entsteht eine Infrastruktur, die es den Bewohnern einfacher macht, ein Leben nach den Grundsätzen der 2000-Watt-Gesellschaft zu führen», sagt Daniel Kellenberger.
Das 2000-Watt-Zertifikat für ganze Areale
Mit dem 2000-Watt-Zertifikat wird es erstmals möglich, ganze Areale aufgrund unterschiedlicher Kriterien umfänglich zu beurteilen und energietechnisch zu bewerten. Damit erweitert sich der Blickwinkel. Das ist neu. Bislang lag hier der Fokus meist auf einzelnen Gebäuden. «Gerade auch für den Einsatz erneuerbarer Energie- und Speichersysteme ergeben sich dadurch ganz neue Perspektiven», sagt Kellenberger.
Als rechnerische Bewertungsgrundlage für die Zertifizierung dient der SIA-Effizienzpfad Energie. «Mit ihm wurde es erstmals möglich, eine rechnerische Grundlage zu schaffen, um die energietechnischen Ziele pro Kopf auf den Quadratmeter in Gebäuden herunterzubrechen», erklärt Kellenberger. Der Effizienzpfad Energie orientiert sich dabei an den Zielen der Energiestrategie 2050, wonach die Bevölkerung der Schweiz bis dann zwei Drittel weniger Energie als heute verbrauchen soll und die Emissionen von Treibhausgasen auf einen Viertel des heutigen Wertes gesenkt werden sollen.
Beispiele für die Zertifizierungskriterien sind ausgefeilte Mobilitätskonzepte, spezifische Ver- und Entsorgungskonzepte, aber auch die Kommunikation unter den Bewohnern der Areale oder die Nutzungsdurchmischung und die bauliche Verdichtung der Gebäude.
Auch Gesamtenergiebilanzen von Arealen werden mit dem SIA-Effizienzpfad erstmals möglich, bei denen die Betriebsenergie von Gebäuden, aber auch die graue Energie für deren Erstellung berücksichtigt werden.
Ein 2000-Watt-Areal werden und bleiben
Das Zertifikat «2000-Watt-Areal» wird in den drei Ausprägungen «Entwicklung», «Betrieb» und «Transformation» vergeben. Sobald 50% eines Areals bezogen sind, kann eine erstmalige Zertifizierung «Betrieb» beantragt werden. Zur Gewährleistung der energietechnischen Nachhaltigkeit eines Areals erfolgt nach zwei bzw. vier Jahren eine Rezertifizierung des Areals. Die Grundlage dafür bilden ein laufendes Monitoring des Energieverbrauchs der Gebäude auf dem Areal sowie der dort anfallenden Alltagsmobilität. Im Fall von Greencity wird die erste Rezertifizierung «Betrieb» im Sommer 2019 erfolgen.